Hermann Melvilles Moby Dick ist ein Buch, das schon zahlreiche Adaptionen in Comicform erfahren hat, zuletzt vom Autorenteam Jouvray und Alary, deren Version 2014 bei Splitter erschienen ist. Seit ich mich durch diese unterschiedlichen Versionen gearbeitet habe, bin ich umso beeindruckter von Jouvrays und Alarys Version, denn es ist alles andere als einfach, dieses Drama visuell aufregend darzustellen und gleichzeitig spannend zu erzählen. Aber wie hat es Philipp S. Neundorf im Comicgate-Interview 2013 zur Frage nach Literatur-Adaptionen einmal schön auf den Punkt gebracht: „Was ich kenne, ist die Lust an einem Stoff, der nicht der eigene ist. […] Man hat einfach manchmal das Gefühl, da will man selber auch mal ran. Das ist ja irgendwo die Grundmotivation, jeden Tag aufs Neue an den Stift zu gehen, um wieder mal eine Figur zu zeichnen: Vielleicht klappt es ja diesmal, den Menschen ganz, ganz neu zu entwerfen.“
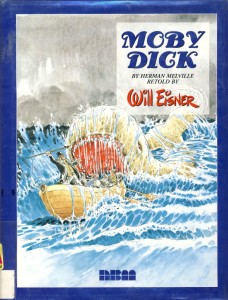 Gegen Ende des letzten Jahrhunderts hat sich Will Eisner der Vorlage angenommen. In dessen Version zeigt sich einmal mehr Eisners Seelenverwandtschaft zu Frank Miller. Beide Künstler arbeiten plakativ und überspitzen gerne, da sie die Stärken des Mediums konsequent im Visuellen sehen und eben nicht auf der Textebene. Entsprechend gelten beide auch als Meister der Reduktion auf das Wesentliche. Wer ausufernde Texte oder gar Psychologie will, so scheint mir Eisners Haltung zu sein, soll einen Roman lesen – für ihn ist der Comic ein Medium, das vor allem die Augen und das Herz begeistern soll. Leider hat Eisner es mit dem Reduzieren bei Moby Dick etwas übertrieben. Jeder Nebenplot und jede Nebenfigur, die vom Haupterzählstrang „Ahab jagt Wal“ abschweift, wird ausgemerzt, so dass das übrigbleibende Gerüst zwar zielstrebig zum Untergang der Pequod führt, aber leider ziemlich belanglos geraten ist. Was bleibt, sind die typischen kernigen Eisner-Figuren, die der Zeichner theatralisch gestikulierend und dynamisch inszeniert. Körperspannung, Bewegung, Gestik und Mimik schüttelt Eisner nur so aus dem Ärmel, doch leider wird seine Meisterschaft schnell zum Dilemma, wenn er sich zu sehr darauf verlässt und das eigentliche Erzählen vernachlässigt. Für Leser, die Melvilles Geschichte kennenlernen wollen, ist Eisners Moby Dick keine geeignete Lektüre. Im Grunde ist sie reines Fan-Futter für die zahlreichen Bewunderer des Künstlers.
Gegen Ende des letzten Jahrhunderts hat sich Will Eisner der Vorlage angenommen. In dessen Version zeigt sich einmal mehr Eisners Seelenverwandtschaft zu Frank Miller. Beide Künstler arbeiten plakativ und überspitzen gerne, da sie die Stärken des Mediums konsequent im Visuellen sehen und eben nicht auf der Textebene. Entsprechend gelten beide auch als Meister der Reduktion auf das Wesentliche. Wer ausufernde Texte oder gar Psychologie will, so scheint mir Eisners Haltung zu sein, soll einen Roman lesen – für ihn ist der Comic ein Medium, das vor allem die Augen und das Herz begeistern soll. Leider hat Eisner es mit dem Reduzieren bei Moby Dick etwas übertrieben. Jeder Nebenplot und jede Nebenfigur, die vom Haupterzählstrang „Ahab jagt Wal“ abschweift, wird ausgemerzt, so dass das übrigbleibende Gerüst zwar zielstrebig zum Untergang der Pequod führt, aber leider ziemlich belanglos geraten ist. Was bleibt, sind die typischen kernigen Eisner-Figuren, die der Zeichner theatralisch gestikulierend und dynamisch inszeniert. Körperspannung, Bewegung, Gestik und Mimik schüttelt Eisner nur so aus dem Ärmel, doch leider wird seine Meisterschaft schnell zum Dilemma, wenn er sich zu sehr darauf verlässt und das eigentliche Erzählen vernachlässigt. Für Leser, die Melvilles Geschichte kennenlernen wollen, ist Eisners Moby Dick keine geeignete Lektüre. Im Grunde ist sie reines Fan-Futter für die zahlreichen Bewunderer des Künstlers.
Besser als Eisner gefällt mir tatsächlich die ursprüngliche Classics Illustrated-Version von Albert Kanter und Louis Zansky aus den 1940er Jahren, auch wenn die altehrwürdige Institution der Illustrierten Klassiker natürlich selten Meisterwerke der grafischen Erzählform hervorgebracht hat. Aber sie ist angenehm unprätentiös und bietet solides Handwerk. Die Einteilung in Kapitel verleiht der Erzählung einen gewissen Rhythmus, außerdem wird immer wieder die Form der Panels variiert, was den Seiten einen reizvollen Look verleiht. Doch natürlich handelt es sich um eine reine Digest-Version, die aber auch gar nicht mehr sein möchte. Gut möglich, dass in Will Eisners Adaption mehr künstlerische Vision steckt als in dieser Digest-Version, aber unterm Strich bieten die Classics Illustrated mehr Ahnung von der Vielschichtigkeit und dem Humor des ursprünglichen Werks.

Die Classics Illustrated–Fassung von 1941 hat Charme. Hier eine Szene in der neukolorierten Fassung von 1997. © Twin Circle Publishing Co., © Acclaim Books, Inc.
 Es gab aber noch weitere Adaptionen unter dem Classics Illustrated-Imprint. Diese zweite Version ist es, die in den 1950er Jahren auch in Deutschland beim BSV-Verlag erschienen ist. Sie ist um einiges statischer und dadurch langweiliger geraten als die erste Fassung, wie man beim Gegenüberstellen der beiden Bildbeispiele, welche die gleiche Szene erzählen, unschwer erkennen kann. Dennoch ist es reizvoll zu vergleichen, wie die Illustrierten Klassiker beide Male zwar brav nacherzählen, aber ganz unterschiedliche Bilder wählen und unterschiedliche Akzente setzen. Beide Versionen zeichnet ein gutes Fingerspitzengefühl für das Wesentliche aus, dennoch bleiben sie natürlich weitgehend ohne Spannung, wie es bei den Classics Illustrated üblich ist.
Es gab aber noch weitere Adaptionen unter dem Classics Illustrated-Imprint. Diese zweite Version ist es, die in den 1950er Jahren auch in Deutschland beim BSV-Verlag erschienen ist. Sie ist um einiges statischer und dadurch langweiliger geraten als die erste Fassung, wie man beim Gegenüberstellen der beiden Bildbeispiele, welche die gleiche Szene erzählen, unschwer erkennen kann. Dennoch ist es reizvoll zu vergleichen, wie die Illustrierten Klassiker beide Male zwar brav nacherzählen, aber ganz unterschiedliche Bilder wählen und unterschiedliche Akzente setzen. Beide Versionen zeichnet ein gutes Fingerspitzengefühl für das Wesentliche aus, dennoch bleiben sie natürlich weitgehend ohne Spannung, wie es bei den Classics Illustrated üblich ist.

Etwas statisch geraten: Szene aus der zweiten Fassung der Illustrierten Klassiker. © Berkley Publishing Group and First Publishing Inc.
Eine radikal andere Version erschien 1990, ebenfalls unter dem Umbrella-Titel Classics Illustrated. Es war die Zeit, als der amerikanische Berkley-Verlag das Konzept modernisierte und immer wieder angesagte Künstler wie Kyle Baker, P. Craig Russel oder Jill Thompson für Adaptionen engagierte, um mehr zu bieten als reine Plot Summaries in Comicform. Bill Sienkiewicz gestaltete eine beachtliche Version von Moby Dick, die eine gänzlich andere Vision verfolgte als die anderen Adaptionen. Er bebildert den Roman im Stil seiner Elektra– und Daredevil-Comics in einer Mal- und Collagentechnik, die auch nach über 20 Jahren noch zum radikalsten gehört, was die Gattung zu bieten hat. Sienkiewicz hat dabei mit dem filmischen Erzählstil der meisten modernen Comiczeichner nicht viel am Hut. Er erzählt bewusst nicht szenisch, sondern pickt sich markante und prägnante Szenen des Romans heraus, um diese mit Textblöcken und avantgardistischen Illustrationen auf den Punkt zu bringen. Ihm gelingt es dabei als einzigem Künstler, die Essenz des Romans, die ja weit über den Plot hinausweist, adäquat umzusetzen. Es ist erstaunlich, wie es Bill Sienkiewicz schafft, auf den 48 Seiten seiner Adaption sämtliche Schlüsselszenen des Romans unterzubringen und dabei auch Raum für die essayistischen und enzyklopädischen Abschweifungen findet. Damit wird die Adaption sperriger, imitiert aber im Kleinen recht präzise das Wesen des Romans. Ein wenig geht das auf Kosten der Spannung, aber die Atmosphäre ist atemberaubend und Sienkiewiczs Talent, richtige Typen zu entwerfen, unübertrefflich. Bill Sienkiewicz hat die einzigartige Sensibilität, für jede Szene und für jedes Bild exakt die passendste Entsprechung zu finden. Damit ergänzt er den Roman kongenial und bietet Bilder, die lange nachwirken und die man immer wieder gerne betrachtet.

Eine Melvillsche Abschweifung – und was Bill Sienkiewicz daraus macht. © 1990 by Berkley Publishing Group and First Publishing, Inc.
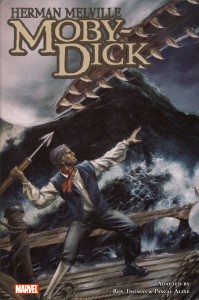 Auch Marvel-Urgestein Roy Thomas hat sich des Stoffs angenommen. Roy Thomas hatte in seiner langen Karriere oft ein sicheres Händchen für Adaptionen, seine Conan– und Elric-Comics beispielsweise werden auch heute noch regelmäßig nachgedruckt. Seine Moby Dick-Adaption von 2008 ist leider nicht sehr überzeugend geraten, was allerdings auch an den Zeichnungen liegt, denen ihr Bemühen um Dynamik anzusehen ist, die aber dennoch oft steif und statisch wirken. Zeichner Pascal Alixe kommt über solides Mittelmaß nicht hinaus und schafft es auch nicht, den Figuren Charakter zu verleihen. Den Rest erledigt die phantasielose Digitalkolorierung und Roy Thomas‘ sperriger Text, der stark am Originaltext angelehnt ist, aber dessen Witz nicht adäquat umsetzen kann. Einzig die Titelbilder von John Watson geben eine Ahnung, wie es auch hätte aussehen können. Aber es ist natürlich einfacher, mit einem prägnanten Bild eine Schlüsselszene auf den Punkt zu bringen, als szenisch und trotzdem anspruchsvoll zu erzählen.
Auch Marvel-Urgestein Roy Thomas hat sich des Stoffs angenommen. Roy Thomas hatte in seiner langen Karriere oft ein sicheres Händchen für Adaptionen, seine Conan– und Elric-Comics beispielsweise werden auch heute noch regelmäßig nachgedruckt. Seine Moby Dick-Adaption von 2008 ist leider nicht sehr überzeugend geraten, was allerdings auch an den Zeichnungen liegt, denen ihr Bemühen um Dynamik anzusehen ist, die aber dennoch oft steif und statisch wirken. Zeichner Pascal Alixe kommt über solides Mittelmaß nicht hinaus und schafft es auch nicht, den Figuren Charakter zu verleihen. Den Rest erledigt die phantasielose Digitalkolorierung und Roy Thomas‘ sperriger Text, der stark am Originaltext angelehnt ist, aber dessen Witz nicht adäquat umsetzen kann. Einzig die Titelbilder von John Watson geben eine Ahnung, wie es auch hätte aussehen können. Aber es ist natürlich einfacher, mit einem prägnanten Bild eine Schlüsselszene auf den Punkt zu bringen, als szenisch und trotzdem anspruchsvoll zu erzählen.

Und noch einmal Queequeg, der Kannibale, wie er sich rasiert. Diesmal in der Version von Alixe und Thomas. © 2008 Marvel Characters, Inc.
Man kann als Comic-Fan nur dankbar sein über die vielen verschiedenen Versionen eines Klassikers wie Moby Dick, über die gelungenen wie die gescheiterten. Sie alle zeigen, wie unterschiedlich das Gelesene durch die Hand des Künstlers transformiert wird und wie jeder Künstler seine Akzente anders setzt. Dass gerade die Ansätze der großen Könner des Mediums in ihrer Blickrichtung auf das, was Comic leisten kann, so unterschiedlich sind, macht den Vergleich zu einer spannenden Angelegenheit. Ich glaube allerdings, dass die ursprüngliche Classics Illustrated-Fassung trotz ihrer Mängel am längsten im kollektiven Gedächtnis verweilen wird. Im Gegensatz zu allen moderneren Ansätzen ist der Titel Classics Illustrated samt ihrem prägnanten Schriftzug zur etablierten Marke geworden – und der schlichte, aber effektive Stil ist so ursprünglich, dass ich ihn fast als archetypischen Comicstil bezeichnen möchte. Trotzdem haben Jouvray und Alary mit der 2014 bei Splitter erschienenen Version sicher eine der unterhaltsamsten und gleichzeitig ambitioniertesten Adaptionen erstellt. Es wird nicht die letzte gewesen sein.







5 Kommentare