Cormac McCarthys Postapokalypse-Klassiker Die Straße ist nun von Manu Larcenet adaptiert worden.
Vater und Sohn. Aber ohne Pointe. Die ganze Welt ist vor die Hunde gegangen, und Vater und Sohn laufen zerlumpt und unrasiert durch die Welt, ständig auf der Suche nach Nahrung, sauberem Wasser und auf der Flucht vor anderen Menschen, denn in dieser Thomas-Hobbes-Welt ist jeder Mensch mehr Gefahr als Gesellschaft. Uns wird eine Welt unter umgekehrten Vorzeichen vorgestellt, in der nur noch Relikte alter Ordnung zu sehen sind. Vater und Sohn sind Überlebende einer nicht näher beschriebenen Globalkatastrophe, die nicht nur die Menschheit dezimiert hat, sondern auch jegliche soziale, technologische oder wirtschaftliche Infrastruktur ausgelöscht hat. In einem Einkaufswagen transportieren Vater und Sohn ihre Habseligkeiten, aber der Konsumalltag, auf den die Story damit anspielt, ist noch weiter entfernt als in der kanonischen Zombiekalypse Dawn of the Dead (1978, dt. Titel Zombies im Kaufhaus).

Ob Rechts- oder Linksverkehr ist Nebensache, wenn es keine Autos mehr gibt, sondern nur noch Vater und Sohn mit einem Einkaufswagen.
Vater und Sohn treffen auf kannibalische Täter und hilflose Opfer, auf Menschen, die sie auf Anhieb überhaupt nicht einordnen können, und auf solche, die sich gar nicht einordnen lassen. Kein Wunder, immerhin inszeniert Larcenet nach McCarthys Originalroman von 2006 auch immer wieder den Zusammenbruch jener alten Ordnung, die den Menschein einst Orientierung bot. Immer wieder stellt er diesen Verlust anhand funktionsloser Strommasten, verwaister Straßen oder durch Straßenlaternen dar, die in dieser Finsternis kein Licht mehr spenden.
Stattdessen durchweht den Comic eine Winterkälte wie etwa Oesterhelds Eternauta, nur dass der Feind hier nicht aus dem Weltall kommt, sondern aus den menschlichen Abgründen zersprengter Menschengruppen, die jegliche Zivilisation hinter sich gelassen und neue grausame Ritualkulturen etabliert haben. Kunst mit Knochen könnte deren makabres Mantra lauten.

Die Konsumartikel der untergegangenen Welt bieten zwar eine kurze Erfrischung, aber deren Buntheit spendet keinen Trost mehr.
Und die Farben: Das Schwarzweiß ist immer mal wieder dezent eingetönt, aber erst spät wird uns klar, dass die Farblosigkeit nicht nur Resultat einer technischen Entscheidung des Zeichners war, sondern die von der Hoffnungslosigkeit getrübte Perspektive der beiden Hauptfiguren widergibt. Eine bunte Tüte gerösteter Sonnenblumenkerne macht uns klar, dass diese Welt tatsächlich noch grauer ist als wir bis zu diesem Zeitpunkt dachten, denn offenbar kennt dieser Comic ja Farbigkeit, nur bietet die trostlose Welt schlichtweg nichts Buntes mehr. Als sie schließlich ihren Sehnsuchtsort, das Meer, erreichen, ist der Vater enttäuscht: „Es tut mir leid … das Meer ist nicht blau“.
Larcenet zeichnet mit feinem Strich und in Anlehnung an Kupfer- oder Holzstiche eine Welt voller Details, in der die Ruinen der Zivilisation neben der unbeugsamen Natur stehen. Und der Mensch versucht, irgendwo dazwischen einen Platz zu finden.
Viele der ungleichmäßigen Bildfolgen sind stumm, und selbst da, wo wir einem Gespräch beiwohnen, ist das nicht sehr mitreißend: „Ich habe Angst, Papa … – Ich weiss.“ Die Gespräche sind so karg wie die Umwelt, so sehr aus den Fugen geraten wie die Strukturen. Das Verhältnis von Vater und Sohn ist geprägt von Liebe, Sorge, Vertrauen und der Suche nach Orientierung. Und irgendwann muss natürlich der Sohn seinen eigenen Weg gehen. Als die beiden überraschend einen mit Lebensmitteln gefüllten Keller entdecken, werden die Panels plötzlich regelmäßig und zeigen symmetrische Bilder einer Ordnung, die bald wieder von den Sorgen vor kannibalischen Horden überschattet wird.

Die gleichmäßige Panelstruktur spiegelt die Ordnung wider, die Vater und Sohn kurzzeitig gefunden haben. Als äußere Anzeichen der alten Verhältnisse schneiden sie sich die Haare (zumindest versuchsweise) und genießen den Luxus, in der Literatur Erfahrungen zweiter Ordnung zu machen.
Die Erzählung hat auch etwas Repetitives (das gilt für den Roman wie auch den Comic), aber es ist eben auch keine Actionstory a la I am Legend, sondern eine sehr gemächliche Studie zweier Menschen am Abgrund. Der Comic ist angesichts der drastischen Bilder viel expliziter als die Romanvorlage, wirkt manchmal wie der Flirt mit dem Horrorgenre, den der Roman vermeidet. Diese Verschiebung entspricht etwa der Überraschung, die man bei dem jüngsten The-Batman-Film haben konnte, wenn man nicht allzufrüh eingeschlafen ist. Wie auch in jenem Fall ist diese Explizitheit vielleicht nicht nötig und ein wenig Effekthascherei, aber sie setzt auch den Schrecken dieser Welt schonungslos ins Bild. Trost steckt nur in der Gewissheit, dass noch eine Patrone im Revolver steckt, und diese wird nicht der Verteidigung dienen, sondern der Erlösung.
An einen Larcenet-Comic hohe Erwartungen heranzutragen, ist selbstverständlich, immerhin haben Blast oder Der alltägliche Kampf auf sehr unterschiedliche Weise die Leser:innen begeistert. In Die Straße ist (ganz und gar der Vorlage entsprechend) im Gegensatz zu Der alltägliche Kampf kein Humor zu entdecken. Das Ende, so suggeriert uns diese düstere Endzeitgeschichte, wird nicht aussehen wie aus Hollywood.
Kein Licht am Ende der Straße
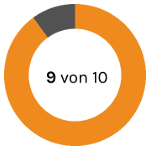 Die Straße – Nach dem Roman von Cormac McCarthy
Die Straße – Nach dem Roman von Cormac McCarthyReprodukt Verlag, 2024
Text und Zeichnungen: Manu Larcenet
Übersetzung: Maria Berthold und Heike Drescher
150 Seiten, schwarz-weiß, Hardcover
Preis: 25,00 Euro
ISBN: 978-3-95640-423-8
Leseprobe






1 Kommentare