1984, das Orwell-Jahr, ein bunter Herbst, irgendwo in der französischen Provinz: Die beiden jugendlichen Nichtsnutze Samuel und Henri stehen vor ihrem letzten Schuljahr und damit, eigentlich, vor einem Jahr ohne Blödsinn, und vor allem ohne ihr Pen-and-Paper-Rollenspiel Call of Cthulhu, das sie gerne mit der Außenseiterin Marie bekifft auf dem örtlichen Friedhof spielen.
Seit Samuel und Henri die einäugige Oriane, eine Teenagerprinzessin, die sich für eine Hexe hält, mit Blut bespritzt haben, hat vor allem Orianes Mutter, die Bürgermeisterin, die sensiblen Hänger auf dem Kieker. Doch dann taucht die betörende Melusine neu in der Schule auf. Melusine sieht aus wie die junge Brigitte Bardot, trägt einen antiken Anhänger, hinter dem Interpol her ist, und hat angeblich gerade im Meer bei Beirut die untergegangene älteste Stadt der Menschheit untersucht. Ihr Vater ist ein selbsternannter Druide. Samuel und Henri kommt das alles vor wie direkt aus dem Werk von H.P. Lovecraft. Natürlich soll sich Melusine ihrem Rollenspiel anschließen. Genau wie Samuels entfremdeter genialischer Sandkastenfreund Dani, der sich nach Jahren zurückmeldet und mittlerweile an künstlicher Intelligenz arbeitet.
Melusine, Oriane, Chtulhus Ruf und Danis Programmierei prallen in einer unheilvollen Kettenreaktion aufeinander. Braut sich im malerischen Nirgendwo etwa ein Kampf zwischen guten und bösen Mächten zusammen? Aber sicher.
Mit ihrem dritten gemeinsamen Comic ist Thierry Smolderen und Alexandre Clérisse etwas absolut Eigenständiges und Eigenartiges gelungen. Ein Jahr ohne Chtulhu ist ein charmanter, alltagsnaher Comic über die 1980er, uralte böse Kräfte und den Untergang des menschlichen Bewusstseins, ein leichtfüßiger und liebevoll gestalteter Trip durch eine kleine Welt, in der es von Toten und Traumata und brandgefährlicher Kultur nur so wimmelt. Durch eine luftige Idylle mit durchschlenderten Alleen, Mädchen in Miniröcken und der malerischsten Eiche der Comicgeschichte bricht eine zutiefst fatalistische Horrorerzählung über die Wurzeln des Bösen und die Unmöglichkeit des freien Willens. Und dabei bleibt der Band bis zur letzten Seite lesbar und ansprechend.
Wenn ein modernistischer Werbegrafiker in den frühen 1960ern ein nostalgisches Bilderbuch über die späten 1980er gezeichnet hätte, dann wäre optisch vielleicht ein vergleichbar seltsamer und wunderschöner Bilderstrudel entstanden.
Und wenn Daniel Clowes statt zu Antidepressiva zu halluzinogenen Pilzen greifen würde, wenn David Lynch sich noch für Kultur interessieren und die junge France Gall in seinen Filmen singen lassen würde, wenn Sempé gleichzeitig Paul Auster und alte Monsterbücher illustrieren würde, und die Aufträge würden ihm durcheinandergeraten, dann könnte, vielleicht, etwas annähend ähnliches wie die vorliegende verwickelte Geschichte entstehen.
Wir kennen so einen Stil, mittlerweile: schmale, schlacksige Gestalten, Nadelbäume sind bunte Zacken, Laubbäume Äste vor grünen Wolken, Städte sind pastellfarbene Blöcke. Keine Panelränder, dafür viel Weiß auf den Seiten., stylishe, altmodisch- grelle Hintergrundfarben dunkeln zum Bildrand hin nach. Männer fahren auf Motorrollern, Frauen sind staksige Feen (ja, das wird natürlich durch die Story hinterfragt und gebrochen, wenn auch weniger konsequent als im vorangegangenen Gemeinschaftswerk), und die Sonne sieht aus wie die „Orangina“-Flasche auf einem alten Blechschild. Manche storylastigen kleinen Computerspiele sehen ähnlich aus, nur nicht ganz so gekonnt. Und sie erzählen keine so entfesselten Fabeln. Parallel dazu und im deutlichen Kontrast zur herausgestrichenen Serialität mancher amerikanischer Graphic Novels ist das Layout betont dynamisch: Keine Seite gleicht der anderen, und kaum ein Panel dem anderen. Jedes verzichtet auf eine klassische Normalsicht und zeigt lieber u.a. Landschaften voller Silhouetten oder Monster in verzerrter Untersicht.
Die Geschichte als überladen zu bezeichnen, wäre eine Untertreibung, sie ächzt und quietscht vor Themen und Ideen, und die sind dazu auch noch ziemlich komplex. Ähnlich wie im hübsch verstörenden Vorgänger (keine Storyüberschneidungen) Ein diabolischer Sommer untersuchen Smolderen und Clérisse, inwieweit wir mit Hilfe von Popkultur die dunklen Ecken der Welt gleichzeitig erkunden und ausblenden. Und ob popkulturelle Mythen nicht vielleicht doch Mythen im Sinne der griechischen Mythen sind – Geschichten, die die Kräfteverhältnisse unserer Welt in allegorischer Form beschreiben, beschwören und gesellschaftlich zementieren. An allen Ecken und Enden sind unsere sympathischen Hänger von bösartigen Schatten eingekesselt, ob sie aus sumerischen Überlieferungen oder 8-Bit-Computerspielen entgegenspringen. Unschuld ist da auf Dauer so unmöglich wie ein klarer Kopf. Und ein eigentliches Coming of Age ist in einer so belasteten und belagerten Welt auch nicht mehr möglich (wie bereits das grausige Ende des melancholischen Diabolischen Sommers gezeigt hat).
Zu dieser Themenvielfalt kommt dazu noch ein Sperrfeuer an Zitaten und Anspielungen. So heißt Samuel mit Nachnamen Le Fanu wie der große Horrorschriftsteller, und bereits die erste echte Szene verbindet eine Verneigung vor dem expressionistischen Stummfilm mit einer Parodie auf The Walking Dead. Dass die Geschichte überhaupt noch funktioniert, ist ein kleines Wunder, aber das tut sie. Allerdings gehen leider die philosophische Folgerichtigkeit, die liebevoll ausgemalte Atmosphäre und der spannende Gang der Geschichte auf sehr französische Art Hand in Hand mit einer gewissen kaltschnäuzigen Lässigkeit gegenüber Plot und Figuren. Tragische Schicksale sind da nur Stichwortgeber für das Spiel der Ideen und grauenhafte Todesfälle nur Perlen auf einer Schnur. Ausgefallene Einfälle werden gerne wie Asse auf den Tisch geknallt und liegen dort dann unverbunden herum. Das erinnert ein bisschen an die große Zeit des legendären Comicmagazins (À SUIVRE), nicht zufällig der Zeitpunkt, zu dem die Geschichte spielt.
Warum ist ausgerechnet Charlie Chaplin ein dämonischer Voodoogott? Was ist das für eine Sekte, aus der Marie geflohen ist? Wie geht es Samuels alkoholkrankem Vater nach seinem Selbstmordversuch?
Darauf gibt es keine Antworten. Das ist um so ärgerlicher, als dass Ein Jahr ohne Cthulhu das Gegenteil von leerer Prätention ist. Smolderen und Clérisse können, wollen und liefern eine Menge und meinen es ernst mit ihren Fragen nach Destruktivität und Individualität. Noch schöner wäre es, wenn sie ihre Figuren wenigstens halb so ernst nehmen könnten wie ihre Zitate (ein ausführliches Nachwort von Smolderen erläutert noch einmal seine Sicht auf die Popkultur der 1980er).
Das ist kein Comic zum Weglesen, sondern zum Wieder-, Quer- und Gegenlesen (und sei es, um den Bartresen in Streuselkuchenoptik noch einmal zu bewundern oder den großartigen Schmarrn über die versunkene Stadt Schuruppak nachzulesen). Das ist ein manchmal anstrengendes, unterm Strich vielleicht nur mittelkluges Konzeptalbum, das dich in eine unverwechselbare Stimmung versetzt. Das ist eine runde Sache mit Ecken und Kanten und eine gespenstische Wundertüte, ein Comic, wie für jugendliche Nichtsnutze mit viel furchtsamer Phantasie gemacht.
Wunderschöne, wehmütige Schauergeschichte über das Erwachsenwerden in einer grausamen Welt. Überspannt, gewalttätig und erzählerisch nicht immer überzeugend, aber jetzt schon einer der Comics des Jahres.
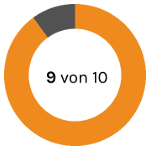 Ein Jahr ohne Cthulhu
Ein Jahr ohne CthulhuCarlsen Comics, 2013
Text: Thierry Smolderen
Zeichnungen: Alexandre Clérisse
Übersetzung: Ulrich Pröfrock
184 Seiten, Farbe, Hardcover
Preis: 24,99 Euro
ISBN: 978-3-551-72820-3
Leseprobe






