In der Kolumne „Währenddessen …“ zeigt die Comicgate-Redaktion, was sie sich diese Woche so zu Gemüte geführt hat.
Daniel: „Universal wollte nicht, dass die Zuschauer mich für ein Arschloch halten.“ Damit erklärt der Schauspieler Jim Carrey, das Aufnahmen vom Set von Man on the Moon nicht veröffentlicht wurden. Fast Zwanzig Jahre nachdem Carrey den Komiker Andy Kaufmann verkörperte, zeigt Netflix nun eben diese Aufnahmen als Dokumentation Jim & Andy: the Great Beyond. Weder beim Anschauen noch danach, dachte ich mir, Jim Carrey sei ein Arschloch. Vielmehr habe ich fast die ganze Zeit durchgelacht. An den Stellen, an denen ich nicht gelacht habe, musste ich fast weinen. Eineinhalb Stunden lang raste mein Hirn.

© Netflix
Aber spulen wir kurz zurück für einen kleinen Kontextabsatz. Der amerikanische Komiker Andy Kaufmann ist nicht zu vergleichen mit anderen Komikern: In den 70er Jahren traf sein bizarrer Anti-Humor auf das amerikanische Zuschauer. Kaufmanns Humor bettelte aber nicht um Lacher. Er machte, was er wollte und brachte mit bizarren Showeinlagen Menschen zum Nachdenken. Als Intergender-Champion wrestelte er nur gegen Frauen, zu einer Zeit als der Feminismus seine Hochphase erlebte. In seinen Karaoke-Einlagen brilliert er nur beim Refrain und bleibt sonst stumm. Seine Sendung zeigte absichtlich ein Testbild, bis Zuschauer beim Sender anriefen. Besser als Jan Böhmermann heute und Harald Schmidt gestern gelang es Kaufmann, das Publikum zu irritieren.
Enter Jim Carry: Die 90er Jahre wiederum wurden humormäßig durch Jim Carrey geprägt. Ein Mensch, der sich vor der Kamera die Nasenlöcher mit den Fingern hochzieht und aus einem Nashorn geboren wird. Ein Quatsch-Komiker, ein Gestengott, ein Körperkünstler. Nach mehreren Quatschkomödien und dem Durchbruch mit der Truman Show nimmt Carrey die Rolle als Kaufmann in Man on the Moon an und brilliert. Als ich 1999 aus dem Kino ging, war ich verzaubert. Wer ist dieser Kaufmann und warum hat sich Carrey in ihn verwandelt? Erst Jim & Andy: the Great Beyond gibt Antworten auf diese Frage. Dazu muss man den sehenswerten Mondmann nicht noch einmal sehen. Es reicht, sich aufs Sofa zu setzen und dem altersweisen Carrey inklusive Rauschebart zu lauschen. Denn der Dokumentarfilm handelt eben so viel von seinem Leben, wie von Kaufmanns.
Eine Doku wie ein Schabernack – ohne Unterbrechung. Bei den Dreharbeiten – das zeigt die Dokumentation – bricht Carrey fast nie aus seiner Rolle als Kaufmann aus. Schlimmer noch, er spielt auch Kaufmanns Alter Ego Toni Clifton, beleidigt andere Schauspieler, verweigert Regisseur Milos Forman den Kontakt zu Jim Carrey. In kurz: Er treibt Kaufmanns Humor auf die Spitze, bis zu dem Punkt, an dem man sich fragt, wer ist eigentlich dieser Jim Carrey, in den sich Andy Kaufmann nach dem Dreh wieder zurückverwandeln muss? Eine beeindruckend mächtige Doku über zwei Komiker in einem Film.
Thomas: Was Coco, den neuen Film der Pixar-Studios, angeht, bin ich einigermaßen zwiegespalten. Es gibt Einiges, was ich an dem Film mag. Im Gesamteindruck fand ich ihn dann aber doch enttäuschend. Coco erzählt die Geschichte eines kleinen mexikanischen Jungen namens – nein, nicht Coco! – Miguel, der davon träumt, Musiker zu werden. Allerdings gilt in seiner Familie seit Generationen ein strenger Musikbann; alles Musikalische ist streng verboten und Miguel muss seiner Leidenschaft im Geheimen nachgehen. Dies führt ihn schließlich am groß gefeierten Día de los Muertos in die Welt der Toten, wo er auf die verstorbenen Mitglieder seiner Familie ebenso trifft auf sein großes Idol- und auf den legendären Sänger Ernesto de la Cruz. Er selber ist aber gar nicht tot und muss nun versuchen, wieder zurück in die Welt der Lebenden zu kommen.
Das große Verdienst des Films ist sicher, dass er es schafft, das Thema Tod spielerisch, originell und einfühlsam in einen kindgerechten Mainstream-Film zu packen. Man wird, wenn man Coco mit Kindern gesehen hat, nicht darum herumkommen, über Tod und Sterblichkeit zu sprechen. Vermutlich ist das schon ein wagemutiger Schritt für einen solchen Film, der ja gleichzeitig auch ein Bedürfnis nach kuscheliger (Vor-)Weihnachtsunterhaltung befriedigen und möglichst auch eine Menge Merchandise verkaufen möchte. Für noch mehr Subversion war dann allerdings kein Platz mehr: Wenn man mal davon absieht, dass in Coco allerhand Tote herumlaufen, hat der Film kaum Ecken und Kanten und erzählt seine nicht allzu originelle Geschichte sehr stromlinienförmig.

© Disney, Pixar
Löblich ist wiederum die Tatsache, dass die Geschichte durchgehend in Mexiko und der dortigen Kultur angesiedelt ist und komplett von nicht-weißen Figuren dominiert wird. Das Setting dient nicht nur als exotischer Hintergrund, sondern ist Dreh- und Angelpunkt der Story. Zwar schrammt man dabei auch gefährlich nahe am Ethno-Kitsch und entwirft eine idealisierte, leicht konsumierbare Mariachi-Welt, die mit der Realität der mexikanischen Gegenwart wenig zu tun hat. Soweit ich das beurteilen kann, geht Pixar trotzdem respektvoll mit der mexikanischen Kultur um. Co-Regisseur und Co-Autor Adrian Molina ist mexikanischer Abstammung, außerdem holte man sich etliche kulturelle Berater an Bord, darunter den Comiczeichner Lalo Alcaraz (La Cucaracha). Dass das funktioniert hat, zeigt sich auch im überwältigenden Erfolg des Films in Mexiko, wo er schon seit Ende Oktober läuft und zum finanziell erfolgreichsten Kinofilm aller Zeiten wurde.
Coco erzählt eine warmherzige, sympathische Geschichte, sieht – vor allem in den Szenen in der Totenwelt – wunderschön aus und ist animationstechnisch mal wieder makellos gemacht. Und trotzdem kann der Film aus meiner Sicht mit großen Pixar-Klassikern wie Toy Story oder den Incredibles nicht mithalten. Es fehlt an originellen Figuren und Szenen, die Lust machen, den Film nochmal zu sehen. Vielleicht steckt in Coco zu wenig Pixar und zu viel Disney, was sich auch in den vielen Gesangseinlagen und dem überdeutlichen Loblied auf die Familie zeigt. Ich jedenfalls musste während der Vorführung mehrmals seufzend an Tim Burtons Corpse Bride denken, der ein ähnliches Thema mit mehr Düsternis behandelt. Und dann gibt’s da ja noch den von Guillermo del Toro produzierten Trickfilm The Book of Life von 2014, der sich genau wie Coco ebenfalls um den Tag der Toten dreht und womöglich der stärkere Film ist.
Stefan: Beim Kamingespräch zum Punisher hatten wir diese Woche gerade festgestellt, dass uns, die wir schon eine Weile aus der Schulzeit heraus sind, die Marvel-Serien von Netflix deutlich besser gefallen als die von DC. Immer wieder gibt es aber gute bis überdurchschnittliche Momente in diesen Serien. Mit dem Crossover-Event in dieser Woche lassen die DC-Shows mal ordentlich die Muskeln spielen. Vier sind es insgesamt: je eine Folge von Supergirl, The Flash, Legends of Tomorrow und Arrow erzählen die Story namens „Crisis on Earth-X“. Flash-Zuschauer bzw. -leser wissen, dass es bei DC ein Multiversum gibt – mehrere Universen in einem. Jedes mit seiner eigenen Variation der Erde. So hat zum Beispiel auf Erde-X Hitler den Krieg gewonnen und nach seinem Tod ist Deutschland noch immer die dominierende Macht, eine düstere Welt voller Hakenkreuzsymbole. In dieser Parallelwelt trägt Supergirl Runen der Schutzstaffel auf der Brust statt dem gewohnten S und sorgt damit für emotional aufgeladene, durchaus verstörende Bilder. Dabei steht doch eigentlich die Hochzeit zwischen Barry Allen / The Flash und Iris West im Zentrum der Geschehnisse, zu deren Fest sind Arrow, die Legends und Co. eingeladen. Allein die schiere Masse an bekannten Superhelden macht dieses Event sehenswert.
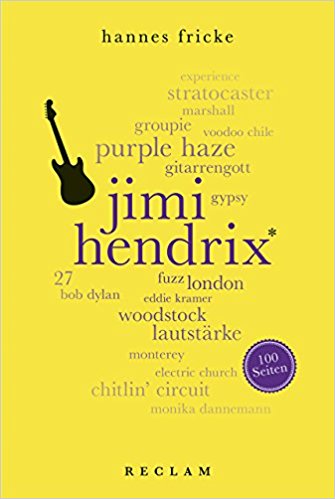
Christian: Völlig spontan habe ich mir kürzlich am Bahnhof die kleine Jimi Hendrix-Biografie von Reclam gekauft, die anlässlich dessen anstehenden 75. Geburtstags erschien. Es war durchaus zu befürchten, dass das dünne Buch arg reduziert sein könnte. Schließlich umfassen andere Biografien locker den fünffachen Umfang, aber das Buch ist außerordentlich gut aufbereitet. Von Hendrix‘ Familiengeschichte bekommt man nur einen notwendigen kurzen Abriss, der Rest ist Analyse seiner Persönlichkeit, seiner Technik und seiner Songs. Also der Teil, der uns auch am meisten interessieren sollte. Volle 28 Seiten des 100-seitigen Bändchens drehen sich um die Stücke Hey Joe, Purple Haze, All Along the Watchtower, Little Wing, Voodoo Child und The Star Spangled Banner. Zwölf davon allein für All Along The Watchtower. Dabei gelingt es Hannes Fricke, dem Stück seine Würde zurückzugeben. Lange Zeit wurde All Along the Watchtower, welches ursprünglich ja von Bob Dylan ist, recht eindeutig interpretiert: Der „Joker“ im Text ist Bob Dylan und der „Thief“ ist sein Manager, die sich beim Autofahren unterhalten und später im Büro sitzen und die Sirenen der Stadt hören. Mir kam regelmäßig das kalte Grausen, wenn ich diesen atemberaubenden Song mit solchen Bildern in Verbindung brachte. Fricke jedoch erinnert uns daran, dass Hendrix sicher nicht solchen Bullshit im Sinn hatte. Sein Kopf war voll mit Science-Fiction-Motiven, von daher liegen eher biblische und apokalyptische Assoziationen nahe. Gut, dass mal klargestellt wurde, dass man das Stück vielleicht doch anders rezipieren sollte, als es viele fantasielose Studienräte tun, die ihre Schüler zu allzu eindeutigen Interpretationen nötigen.
Was habt ihr diese Woche gekauft, gesehen, gelesen, gespielt? Postet eure Bilder, Geschichten und Links einfach in die Kommentare.



